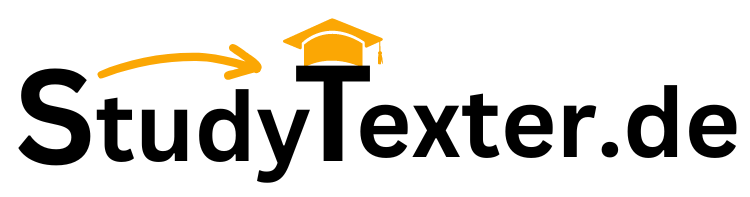Die Diplomarbeit stellt für viele Studierende einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Abschluss dar. Sie verlangt nicht nur tiefgehendes Fachwissen, sondern auch die Fähigkeit, eigenständig zu forschen, zu analysieren und präzise Ergebnisse zu präsentieren.
In diesem umfassenden Guide begleiten wir dich durch den gesamten Prozess – von der Themenfindung über die richtige Methodik bis hin zur finalen Abgabe. Du erfährst, wie du deine Diplomarbeit strukturiert und zielgerichtet aufbaust, welche wissenschaftlichen Standards du einhalten musst und wie du typische Fallstricke vermeidest. Mit praktischen Tipps und klaren Handlungsempfehlungen helfen wir dir, die Herausforderung erfolgreich zu meistern.
Hausarbeiten mit KI. Bis 120 Seiten in unter 4h
Lass dir einen kompletten Entwurf deiner wissenschaftlichen Arbeit auf Expertenniveau in unter 4h erstellen und spare dir Monate an Arbeit.
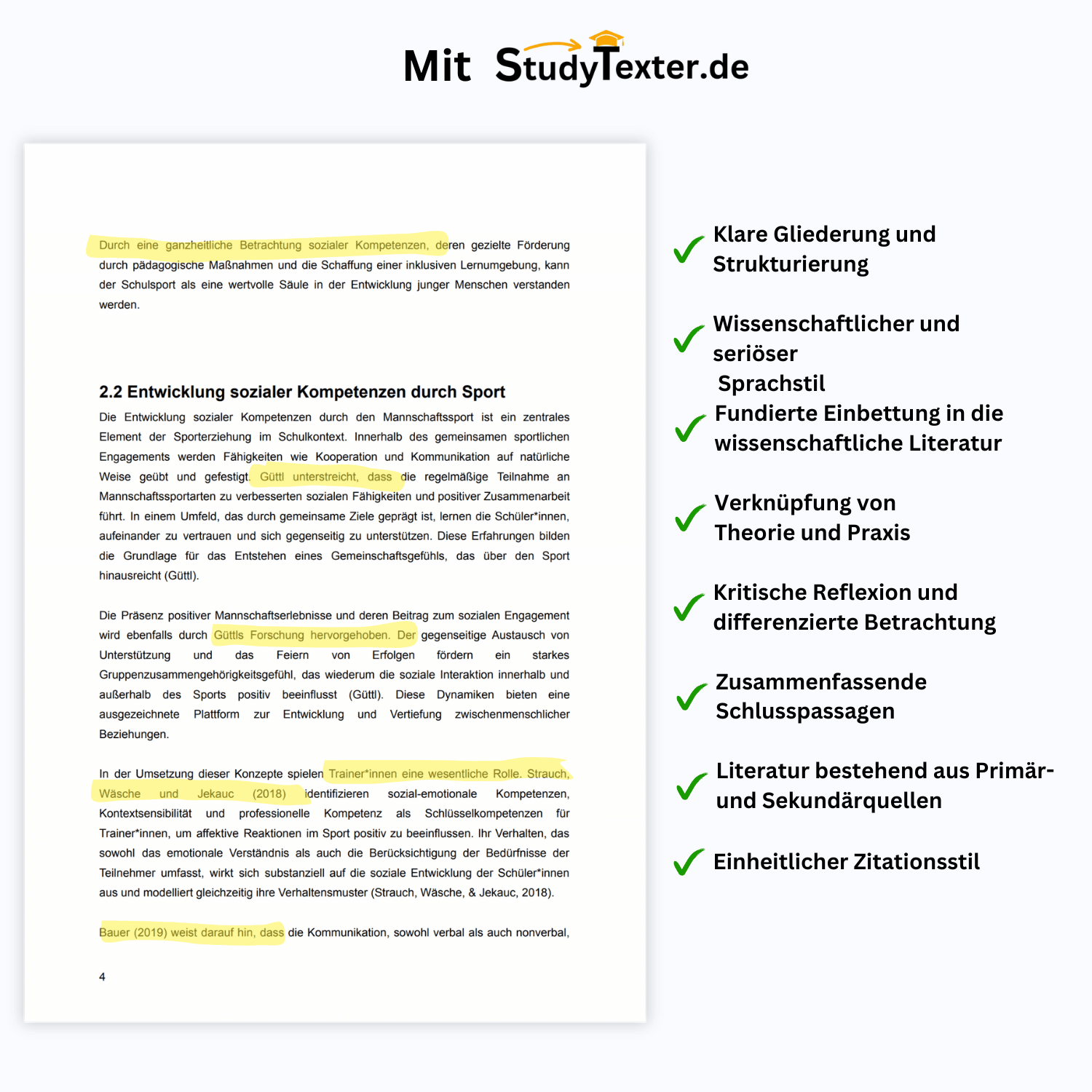

Was ist eine Diplomarbeit? Definition und Anforderungen
Eine Diplomarbeit bezeichnet in Deutschland und Österreich die schriftliche Abschlussarbeit eines Diplom-Studiengangs an einer Hochschule oder Berufsakademie. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Diplomprüfung und führt zusammen mit weiteren Leistungen wie Klausuren und mündlichen Prüfungen zur Erlangung des akademischen Diplomgrades. Durch diese wissenschaftliche Arbeit sollst du nachweisen, dass du fähig bist, ein Problem innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.
Umfang und Bearbeitungszeit einer Diplomarbeit
Der durchschnittliche Umfang einer Diplomarbeit liegt zwischen 60 und 100 Seiten. Allerdings kann dies je nach Hochschule und Studiengang variieren. Manche Institutionen legen den Regelumfang auf 30 bis maximal 70 Seiten fest. Bei experimentellen Themen oder umfangreichen Messungen können ausführliche Labor- oder Messprotokolle als Anhang beigefügt werden.
Was die Bearbeitungszeit betrifft, beträgt diese durchschnittlich sechs Monate. In manchen Bundesländern ist diese Zeit gesetzlich geregelt. So dürfen Diplomarbeiten in Nordrhein-Westfalen höchstens vier Monate in Anspruch nehmen, bei empirischen, experimentellen oder mathematischen Themen höchstens sechs Monate. In den Fächern Physik und Biologie kann die Bearbeitungszeit sogar bis zu neun Monate betragen.
Unterschied zur Bachelor- und Masterarbeit
Mit dem Bologna-Prozess laufen an vielen Hochschulen die Diplomstudiengänge aus und werden durch Bachelor- und Masterstudiengänge ersetzt. Daher ist es wichtig, die Unterschiede zu kennen:
Die Diplomarbeit ist in ihrer Bedeutung gleichrangig mit der Masterarbeit. Beide erfordern einen ähnlichen Umfang (60-100 Seiten) und eine vergleichbare Bearbeitungszeit (etwa 6 Monate). Im Gegensatz dazu hat eine Bachelorarbeit einen geringeren Umfang von etwa 30-40 Seiten und eine kürzere Bearbeitungszeit von 3-4 Monaten.
Ein wesentlicher Unterschied liegt im wissenschaftlichen Anspruch: Bei einer Bachelorarbeit geht es hauptsächlich um die Reproduktion von erlerntem Wissen. Sie ist oft die erste wissenschaftliche Arbeit und soll beweisen, dass du grundlegende wissenschaftliche Methoden beherrschst. Bei der Diplomarbeit hingegen werden, ähnlich wie bei der Masterarbeit, neue Erkenntnisse erwartet. Du sollst eigenständig forschen und einen Beitrag zur Wissenschaft leisten.
Außerdem unterscheiden sich die Anforderungen an die Betreuung: Während für eine Bachelorarbeit ein Dozent ausreicht, muss der Betreuer einer Master- oder Diplomarbeit in der Regel Professor oder Privatdozent sein.
Wissenschaftliche Ansprüche verstehen
Eine Diplomarbeit muss hohen wissenschaftlichen Standards genügen. Zunächst sollte deine Forschungsfrage klar definiert sein. Durch die Arbeit musst du nachweisen, dass du in der Lage bist, nach wissenschaftlichen Grundsätzen eigenständig zu arbeiten.
Folgende wissenschaftliche Ansprüche sind besonders wichtig:
- Nachvollziehbarkeit: Der Weg zum Erkenntnisgewinn muss für andere nachvollziehbar sein. Begriffe müssen klar definiert und Methoden offengelegt werden.
- Zuverlässigkeit: Die verwendeten Verfahren sollten bei Wiederholung unter gleichen Bedingungen die gleichen Ergebnisse liefern.
- Validität: Die Ergebnisse müssen gültig und belastbar sein.
- Zugänglichkeit: Die Arbeit sollte für interessierte Kreise verständlich sein.
Eine Diplomarbeit muss zudem bestimmte formale Anforderungen erfüllen, wie ein korrektes Titelblatt, ein Inhaltsverzeichnis, ein Abkürzungsverzeichnis, den Textteil, ein Literaturverzeichnis und gegebenenfalls Anlagen. Besonderes Augenmerk gilt der korrekten Zitation – wörtliche und indirekte Zitate müssen eindeutig gekennzeichnet sein.
Wie beginne ich eine Diplomarbeit? Die Vorbereitungsphase
Die Vorbereitungsphase gilt als entscheidender Grundstein für deine Diplomarbeit. Bevor du mit dem eigentlichen Schreiben beginnst, musst du wichtige Vorarbeiten leisten, die den Erfolg deiner wissenschaftlichen Arbeit maßgeblich beeinflussen. Diese Phase umfasst die Themenfindung, die Suche nach einem geeigneten Betreuer und die Erstellung eines Exposés.
Themenfindung: Interessen und Forschungslücken identifizieren
Bei der Themenwahl solltest du zunächst reflektieren, wo deine eigenen Interessen sowie Stärken und Fähigkeiten liegen. Beschränke dich dabei nicht nur auf die reinen Inhalte deines Studiengangs – oft verstecken sich die interessanteren Themen etwas tiefer in den einzelnen Fachbereichen.
Um ein passendes Thema zu finden, ist eine gründliche Literaturrecherche unverzichtbar. Diese dient nicht nur der Themenfindung, sondern hilft dir auch, jene Themen auszuschließen, zu denen zu wenig Fachliteratur für die weiterführende Recherche existiert. Die Analyse wissenschaftlicher Datenbanken wie Google Scholar, EBSCO oder SpringerLink mit relevanten Suchbegriffen auf Deutsch und Englisch kann dir dabei helfen, den aktuellen Forschungsstand zu ermitteln.
Besonders wertvoll für deine Themenfindung sind sogenannte Forschungslücken – Bereiche, die bislang nicht ausreichend erforscht wurden. Diese identifizierst du, indem du dir folgende Fragen stellst:
- Welche Fragen sind in diesem Themengebiet noch ungeklärt?
- Welche offenen Fragen sind von Relevanz?
- Zur Beantwortung welcher Fragen kann ich einen Beitrag leisten?
Nach der Themenfindung musst du eine konkrete Forschungsfrage formulieren. Diese muss nicht zwingend als Frage erfolgen – auch eine Behauptung, eine Umsetzung oder ein Themenbereich kann diskutiert werden.
Betreuer finden und erste Gespräche führen
Die Betreuungsperson ist nicht nur für die Beurteilung deiner Arbeit zuständig, sondern hilft dir auch, auf Kurs zu bleiben. Ihre Aufgabe besteht darin, die Wahl eines geeigneten Themas sicherzustellen, die Gliederung der Arbeit zu überprüfen und Tipps zu wichtiger Literatur zu geben.
Bei der Suche nach einem Betreuer ist es ideal, wenn du bereits konkrete Vorstellungen zu deiner Diplomarbeit hast. Am einfachsten fragst du Dozenten an, die du bereits aus dem Unterricht kennst. Allerdings sollte die Fachkompetenz des Betreuers in einem spezifischen Gebiet nicht das primäre Auswahlkriterium sein – ebenso wichtig ist, dass es auf der persönlichen Ebene passt und dein Betreuer dich motivieren kann.
Für ein erfolgreiches erstes Gespräch solltest du gut vorbereitet sein. Überlege dir 2-3 interessante Themen, recherchiere sie an und tausche dich darüber mit deinem Dozierenden aus. Zudem ist es hilfreich, alle deine Fragen zur Diplomarbeit zu sammeln – etwa zur Seitenanzahl, Zitationsweise oder benötigten Quellen.
Exposé erstellen: Dein Fahrplan zum Erfolg
Das Exposé bildet den Abschluss der Orientierungs- und Planungsphase und ist ein wichtiger Zwischenschritt in deinem Schreibprojekt. Es fasst die Ergebnisse der Planungsphase zusammen und gibt einen Überblick über den Inhalt deiner Arbeit. Damit informierst du nicht nur deinen Betreuer, sondern schaffst auch für dich selbst Klarheit über dein Vorhaben.
Ein Exposé für eine Diplomarbeit umfasst typischerweise fünf bis zwanzig Seiten und sollte folgende Elemente enthalten:
- Die Problemstellung deines Schreibprojekts
- Den aktuellen Forschungsstand zum Thema
- Deine Fragestellung und dein Erkenntnisinteresse
- Das Ziel bzw. die der Arbeit zugrundeliegende Hypothese
- Die Theorie(n) und Methode(n), auf die du dich beziehst
- Die Quellen bzw. das Material, das du verwenden wirst
- Eine vorläufige Gliederung
- Einen Zeitplan bis zum Abgabetermin
Beachte jedoch: Ein Exposé ist lediglich eine „provisorische Skizze“. Die Gliederung und Einleitung deiner Arbeit werden sich während des Schreibprozesses vermutlich noch ändern. Dennoch dient es als wertvolle Orientierungshilfe und verhindert, dass du das Ziel deiner Arbeit aus den Augen verlierst.
Studienstress und Zeitmangel? Hier deine Lösung
Probleme mit deiner wissenschaftlichen Arbeit?
- Zermürbende, wochenlange Quellensuche
- Langes, anstrengendes überlegen wie welche Argumente aufeinander aufbauen
- Schwierig einen logischen Grundaufbau zu finden, der deinem Thema gerecht wird
- Jede einzelne These mühsam mit individuellen Textbelegen versehen
- Alles ausformulieren auf über 40+ Seiten Fließtext, bis die Finger weh tun
- Hunderte Stunden investieren, in denen du arbeiten, dich mit Freunden treffen oder anders weiterbilden kannst
- Es ist einfach zu wenig Zeit neben Arbeit und all dem was sonst noch jeden Tag passiert

Das löst StudyTexter für dich
- Bis zu 120 Seiten Fließtext. Mit echten Fakten, aus echten Quellen und logisch strukturiert von vorne bis hinten
- Umfassendes separates Literaturverzeichnis mit Zusammenfassung zu jeder Quelle
- Vollautomatische Quellensuche, individuell auf deine wissenschaftliche Arbeit abgestimmt
- Professionelle Quellenvalidierung mit KI
- Bequem und sicher von zuhause aus bestellen und in unter 4 Stunden per E-Mail erhalten
- Direkt mit einem Entwurf arbeiten, den es so nur 1 mal auf der Welt gibt - nur auf dich und deine Arbeit abgestimmt arbeiten
- Professionell, mit unabhängigen Anbieter auf Plagiate geprüft
- Professionell, mit unabhängiger Software auf KI geprüft
Die richtige Forschungsfrage formulieren
Nach der Vorbereitungsphase steht die Formulierung einer präzisen Forschungsfrage im Mittelpunkt deiner wissenschaftlichen Arbeit. Sie bildet das Herzstück deiner Diplomarbeit und bestimmt maßgeblich, ob dein Projekt gelingt oder scheitert.
Kriterien einer guten Forschungsfrage
Eine zielführende Forschungsfrage erfüllt mehrere zentrale Kriterien. Zunächst sollte sie präzise formuliert und auf ein einzelnes spezifisches Thema begrenzt sein. Außerdem muss sie für dein Studienfach relevant und innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens beantwortbar sein.
Die Forschungsfrage sollte:
- In einem Satz formuliert werden und nicht mehrere Fragen enthalten
- Offen gestellt sein, damit sie nicht mit einem einfachen „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann
- Komplex genug sein, dass eine ganze Diplomarbeit für ihre Beantwortung erforderlich ist
Es empfiehlt sich, deine Fragestellung als W-Frage zu formulieren (Wie, Was, Wer, Warum, Welche, Wann). Besonders Wie-Fragen eignen sich hervorragend für den Einstieg, da sie den Fokus schärfen. Dennoch solltest du „Warum“-Fragen mit Vorsicht betrachten, denn sie können oft auf verschiedene Weise beantwortet werden.
Eingrenzung des Themas
Die Eingrenzung deines Themas ist entscheidend für den Erfolg deiner Arbeit. Hierfür kannst du verschiedene Dimensionen nutzen:
Zeitlich eingrenzen: Beschränke dich auf einen bestimmten Zeitraum oder historischen Abschnitt. Räumlich begrenzen: Lege ein spezifisches Land oder eine Region fest. Nach Personengruppen differenzieren: Konzentriere dich auf eine bestimmte demografische Gruppe.
Ein zu weit gefasstes Thema führt häufig dazu, dass Studierende den eigenen Anforderungen nicht gerecht werden können. Wähle dein Thema daher lieber zu konkret als zu allgemein. Die Eingrenzung erleichtert nicht nur die Literaturrecherche, sondern macht dein Projekt auch zeitlich und inhaltlich beherrschbar.
Methodik auswählen
Die Wahl der richtigen Forschungsmethode ist wesentlich für die Beantwortung deiner Fragestellung. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen qualitativen und quantitativen Methoden.
Bei der Methodenauswahl solltest du folgende Fragen beantworten:
- Möchtest du eigene Daten erheben? (Erhebungsmethoden)
- Möchtest du bestehende Daten analysieren? (Auswertungsmethoden)
- Sollen auf Basis dieser Daten neue Konzepte erarbeitet werden? (Kreativmethoden)
Zur Verfügung stehen dir beispielsweise Umfragen, Experteninterviews, Beobachtungen, Literaturarbeiten, Inhaltsanalysen oder Experimente. Für die Auswahl der passenden Methode ist entscheidend, dass sie zur Beantwortung deiner Forschungsfrage geeignet ist. Daher solltest du dich vorab gründlich über verschiedene methodische Ansätze informieren.
Bedenke jedoch: Die beste Methode ist nicht immer die komplexeste. Oftmals ist es sinnvoller, eine Methode zu wählen, mit der du bereits vertraut bist. Sprich bezüglich der Methodenwahl in jedem Fall mit deinem Betreuer, um sicherzustellen, dass dein Vorgehen wissenschaftlich fundiert ist.
Effektive Literaturrecherche für deine Diplomarbeit
Eine gründliche Literaturrecherche bildet das Fundament deiner Diplomarbeit. Nach der Formulierung deiner Forschungsfrage ist es entscheidend, relevante Fachliteratur zu finden, die dir hilft, den aktuellen Forschungsstand zu erfassen und deine eigene Arbeit wissenschaftlich zu untermauern.
Wissenschaftliche Datenbanken nutzen
Für eine qualitativ hochwertige Diplomarbeit reicht die Google-Suche allein nicht aus. Wissenschaftliche Datenbanken bieten dir Zugang zu Fachzeitschriften und aktueller Forschungsliteratur, die du für deine Arbeit benötigst. Im Gegensatz zu allgemeinen Suchmaschinen verzeichnen Datenbanken Artikel systematisch und ermöglichen eine strukturierte Suche.
Die Wahl der passenden Datenbank hängt von deinem Fachgebiet ab. Für wirtschaftswissenschaftliche Themen eignen sich beispielsweise ABI/Inform Global oder EBSCO Business Source Premier besonders gut. Zusätzlich bieten fachübergreifende Plattformen wie JSTOR oder SpringerLink umfangreiche kulturelle und internationale Inhalte.
Profi-Tipp: Wenn du einen gut passenden Artikel gefunden hast, nutze diesen als Ausgangspunkt für deine weitere Recherche! Viele Datenbanken bieten Funktionen wie „Ähnliche Artikel anzeigen“ oder zeigen dir, welche Quellen der Artikel zitiert.
Quellen bewerten und organisieren
Nicht jede Quelle ist für deine Diplomarbeit geeignet. Bei der Bewertung solltest du folgende Kriterien berücksichtigen:
- Autorität: Ist der Autor als Experte auf seinem Gebiet anerkannt? Arbeitet er an einer Hochschule oder Forschungseinrichtung?
- Aktualität: Ist die Quelle noch relevant? Besonders in schnelllebigen Fachgebieten ist dies wichtig
- Objektivität: Vertritt die Quelle eine faire und hilfreiche Sichtweise oder ist sie voreingenommen?
- Relevanz: Hilft die Quelle tatsächlich bei der Beantwortung deiner Forschungsfrage?
Um den Überblick zu behalten, ist eine systematische Organisation deiner Quellen unerlässlich. Lege bereits von Beginn an eine Liste aller Quellen mit vollständigen bibliografischen Angaben an, entweder in Word, Excel oder einem Literaturverwaltungsprogramm wie Citavi, Zotero oder Mendeley.
Exzerpte erstellen und verwalten
Exzerpte helfen dir, wichtige Informationen aus deinen Quellen festzuhalten und später wiederzufinden. Ein Exzerpt ist mehr als eine reine Zusammenfassung – es enthält auch eigene Gedanken, Kommentare und Fragen zum Text.
Ein vollständiges Exzerpt sollte folgende Elemente enthalten:
- Vollständige bibliografische Angaben inkl. Signatur und Fundort
- Zusammenfassung der Kernaussagen mit Seitenangaben
- Kennzeichnung von wörtlichen Zitaten und Paraphrasen
- Eigene Anmerkungen und Ideen
Beim Exzerpieren arbeitest du konzentrierter und liest die Texte gründlicher, was zu einem besseren Textverständnis führt. Außerdem sparst du dir später Zeit, da du nicht erneut nach relevanten Textstellen suchen musst.
Je nach Arbeitsphase kannst du unterschiedlich vorgehen: Zu Beginn empfehlen sich umfangreichere Exzerpte, um einen Überblick zu gewinnen. Später, wenn deine Fragestellung konkreter wird, kannst du gezielter exzerpieren und nur noch die für deine Arbeit relevanten Informationen festhalten.
Denke daran: Eine systematische Literaturrecherche steht zwar am Anfang jeder wissenschaftlichen Arbeit, begleitet dich allerdings während des gesamten Schreibprozesses. Mit jeder Phase der Texterstellung wird immer wieder eine Recherche nach neuen Schlagworten nötig sein.
Diplomarbeit richtig strukturieren
Eine logische Gliederung bildet das Rückgrat deiner Diplomarbeit und garantiert nahezu einen „roten Faden“ durch die gesamte Arbeit. Mit einer durchdachten Struktur vermeidest du, vom eigentlichen Thema abzukommen und erleichterst dir gleichzeitig den Schreibprozess erheblich.
Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit
Der klassische Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit folgt einem bewährten Schema: Einleitung, Hauptteil und Schlussteil. Diese Grundstruktur wird durch weitere essentielle Elemente ergänzt:
- Deckblatt: Enthält Titel, Name der Hochschule, deinen Namen, Matrikelnummer und Betreuername
- Verzeichnisse: Inhalts-, Abbildungs-, Tabellen- und Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung: Einführung ins Thema, Relevanz, Forschungsfrage
- Hauptteil: Theoretische Grundlagen, Methodik, Ergebnisse (macht 70-80% des Gesamtumfangs aus)
- Schlussteil: Zusammenfassung, Beantwortung der Forschungsfrage, Ausblick
- Literaturverzeichnis: Auflistung aller verwendeten Quellen
- Anhang: Ergänzende Materialien
- Eidesstattliche Erklärung: Versicherung der eigenständigen Erstellung
Mit einer klaren Struktur schaffst du eine übersichtliche und verständliche Arbeit, die deinen Lesern hilft, deinen Gedankengängen und Erkenntnissen zu folgen. Achte darauf, dass deine Gliederung logisch aufgebaut ist und jedem Teil der Arbeit genügend Raum für eine fundierte Diskussion und Argumentation bietet.
Einleitung deiner Diplomarbeit schreiben: Der perfekte Start
Die Einleitung ist der erste Eindruck, den deine Leser von deiner Diplomarbeit erhalten. Sie sollte nicht nur das Thema einführen, sondern auch den Rahmen für die gesamte Arbeit setzen und den Leser neugierig machen. Eine gut geschriebene Einleitung schafft Klarheit und legt die Basis für den gesamten wissenschaftlichen Prozess.
Der perfekte Zeitpunkt für das Schreiben der Einleitung
Es ist ratsam, die Einleitung erst am Ende des Schreibprozesses zu verfassen, wenn du die Hauptpunkte deiner Arbeit bereits klar im Kopf hast. So kannst du sicherstellen, dass die Einleitung gut zu deinem Hauptteil und den Ergebnissen passt.
So gelingt dir eine erfolgreiche Einleitung
Führe in das Thema ein: Beginne mit einer kurzen, aber prägnanten Einführung in dein Thema. Stelle sicher, dass es für den Leser verständlich ist und einen klaren Kontext bietet.
Formuliere die Forschungsfrage: Deine Forschungsfrage sollte klar und fokussiert sein, damit der Leser sofort versteht, was die Arbeit beantworten soll. Vermeide zu breite oder unklare Fragen.
Erkläre die Zielsetzung: Was willst du mit deiner Arbeit erreichen? Erkläre, wie deine Forschung zum wissenschaftlichen Diskurs beiträgt.
Gib einen Überblick über die Methodik: Ein kurzer Überblick über die Methoden, die du verwendest, reicht aus. Der genaue methodische Ansatz wird später im Hauptteil behandelt.
Skizziere den Aufbau der Arbeit: Die Einleitung sollte dem Leser einen klaren Überblick darüber geben, was in den folgenden Kapiteln zu erwarten ist.
Länge der Einleitung:
Die Einleitung sollte zwischen 2 und 5 Seiten umfassen, je nach Umfang der Arbeit. Achte darauf, dass sie prägnant bleibt und den Leser direkt in das Thema einführt, ohne unnötige Details.
Den Hauptteil deiner Diplomarbeit verfassen
Der Hauptteil bildet das Herzstück deiner Diplomarbeit und macht etwa 70-80% des Gesamtumfangs aus. Hier zeigst du detailliert, was zur Beantwortung deiner Forschungsfrage notwendig war und welche Ergebnisse dabei herauskamen. Während du mit dem Schreiben beginnst, ist es wichtig, einen roten Faden beizubehalten und deine Argumentation systematisch aufzubauen.
Theoretische Grundlagen darstellen
Zunächst solltest du im Hauptteil einen theoretischen Rahmen für deine Forschung schaffen. Dieser Teil bildet das wissenschaftliche Fundament deiner Diplomarbeit und dient dazu, deiner Leserschaft die Grundlagen zu vermitteln. Die theoretischen Grundlagen sollten etwa 30-40% des Gesamtumfangs deiner Arbeit ausmachen.
In diesem Abschnitt definierst du alle Fachbegriffe, die für das Verständnis deiner Arbeit erforderlich sind. Außerdem präsentierst du relevante Theorien und Konzepte, die als Basis für deine eigene Forschung dienen. Beachte dabei:
- Fasse den aktuellen Forschungsstand deines Themas zusammen
- Stelle sicher, dass du die bedeutendsten Forschenden auf deinem Gebiet berücksichtigst
- Erkläre, welche Methoden und Theorien andere bereits angewendet haben
Methodik beschreiben
Im Methodikteil erklärst du, wie du deine Forschung durchgeführt hast und wie du zu deinen Ergebnissen gekommen bist. Dieser Abschnitt folgt direkt nach dem Theorieteil und sollte etwa 10% deines Textes ausmachen, was bei durchschnittlichem Umfang etwa 1000 Wörter entspricht.
Folgende Elemente sollten im Methodikteil enthalten sein:
- Welche wissenschaftliche Methode du verwendest
- Wie du im Rahmen der Forschung vorgegangen bist
- Ob du eine quantitative oder qualitative Methode verwendest
Darüber hinaus ist es wichtig, die Gütekriterien deiner Forschung darzulegen. Bei quantitativer Forschung sind dies Validität, Reliabilität und Objektivität, bei qualitativer Forschung hingegen Transparenz, Reichweite und Intersubjektivität.
Ergebnisse präsentieren und analysieren
Nach der Methodik folgt die Darstellung deiner Forschungsergebnisse. Der Ergebnisteil macht typischerweise etwa 10-15% deiner Arbeit aus. Bei einer 80-seitigen Diplomarbeit beträgt die Länge dieses Abschnitts folglich ca. 8-12 Seiten.
Im Ergebnisteil werden zwei wesentliche Bestandteile behandelt:
- Darstellung der Forschungsergebnisse bzw. Forschungsdaten
- Interpretation der Daten in Bezug auf die Forschungsfrage(n)
Achte darauf, deine Daten objektiv zu beschreiben und bei quantitativen Ergebnissen relevante Statistiken anzugeben. Zur besseren Veranschaulichung deiner Ergebnisse kannst du Tabellen für genaue Werte und Grafiken für Trends und Beziehungen verwenden.
Ein wichtiger Hinweis: Verwechsle nicht die Rohdaten mit den relevanten Erkenntnissen aus der Forschung. Konzentriere dich darauf, nur jene Daten zu präsentieren, die mit deinen Forschungszielen übereinstimmen. Außerdem gehören Interpretationen und Spekulationen noch nicht in den Ergebnisteil – diese werden erst in der Diskussion behandelt.
Das Fazit: Deine Diplomarbeit erfolgreich abschließen
Das Fazit markiert den krönenden Abschluss deiner monatelangen Arbeit an der Diplomarbeit. In diesem wichtigen Teil fasst du nicht nur zusammen, was du erforscht hast, sondern beantwortest auch deine Forschungsfrage und gibst einen Ausblick auf zukünftige Forschungsmöglichkeiten. Das Fazit macht etwa 5-10% deiner Gesamtarbeit aus und hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei deinen Lesern.
Ergebnisse zusammenfassen
Im ersten Teil deines Fazits stellst du prägnant die wichtigsten Erkenntnisse deiner Forschung dar. Hierbei geht es nicht darum, den gesamten Inhalt zu wiederholen, sondern die aussagekräftigsten Resultate hervorzuheben. Dies ist deine Chance, die Bedeutsamkeit deiner Arbeit zu unterstreichen.
Beim Verfassen dieses Abschnitts beachte folgende Punkte:
- Verwende das Präsens für die Darstellung der Fakten
- Nutze das Präteritum, wenn du auf deine eigene Forschung verweist
- Präsentiere nur Informationen und Schlussfolgerungen, die bereits im Hauptteil vorkamen
Du solltest in diesem Teil keine neuen Ideen, Beispiele oder Zitate einbringen. Stattdessen konzentriere dich auf eine klare, strukturierte Zusammenfassung deiner bedeutendsten Ergebnisse.
Forschungsfrage beantworten
Nachdem du deine Ergebnisse zusammengefasst hast, folgt der entscheidende Schritt: Die Beantwortung deiner Forschungsfrage. Dieser Teil bildet das Herzstück deines Fazits und sollte besonders sorgfältig ausgearbeitet werden.
Deine Forschungsfrage wurde bereits in der Einleitung formuliert und zieht sich wie ein roter Faden durch deine gesamte Arbeit. Im Fazit beantwortest du sie nun abschließend. Dabei ist es wichtig, direkt und präzise zu sein. Beziehe dich explizit auf deine Forschungsfrage und beantworte sie auf Basis deiner Ergebnisse.
Übrigens: Auch wenn deine Ergebnisse nicht deinen ursprünglichen Erwartungen entsprechen – bei einer gut formulierten Forschungsfrage (etwa mit „wie viel“ oder „inwiefern“) wirst du immer wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die die Forschung auf diesem Gebiet weiterbringen.
Ausblick geben
Der Ausblick bildet den letzten Teil deines Fazits und erweitert die Perspektive auf dein Forschungsthema. Hier kannst du:
- Fragen aufgreifen, die in deiner Arbeit unbeantwortet blieben
- Neue Fragen formulieren, die sich aus deinen Ergebnissen ergeben haben
- Vorschläge für weitere Forschungsvorhaben machen
- Vermutungen über zukünftige Entwicklungen äußern
Beachte dabei: Die im Ausblick gestellten Fragen musst du nicht beantworten. Sie sollen vielmehr die Leser auf Forschungslücken aufmerksam machen und zu weiteren Forschungsvorhaben anregen. Der Ausblick ist daher eine Gelegenheit, aufzuzeigen, dass dein Thema noch Potenzial für weitere wissenschaftliche Untersuchungen bietet.
Die Zeitform für den Ausblick ist hauptsächlich das Präsens. Der Umfang des Ausblicks ist vergleichsweise kurz – bei einer Diplomarbeit typischerweise eine halbe bis anderthalb Seiten.
Fachbereich:
Arbeitenart:
Zitationsstil:
Seiten:
Sportpädagogik
Hausarbeit
APA
45
Wissenschaftliches Zitieren in der Diplomarbeit
Korrektes wissenschaftliches Zitieren ist ein unverzichtbarer Bestandteil deiner Diplomarbeit. Die richtige Anwendung von Zitierregeln schützt nicht nur vor Plagiatsvorwürfen, sondern zeigt auch deine Fähigkeit, mit wissenschaftlichen Quellen umzugehen. Daher lohnt es sich, Zeit in das Verständnis der verschiedenen Zitierstile zu investieren.
Zitierstile im Überblick
Für deine Diplomarbeit stehen dir verschiedene Zitierstile zur Verfügung, die sich in zwei wesentlichen Aspekten unterscheiden: der Darstellung im Literaturverzeichnis und der Angabe im Fließtext. Grundsätzlich gibt es drei Hauptsysteme:
APA-Stil (Name-Datum-System / amerikanische Zitierweise): Die Quelle wird direkt im Text mit Autorname und Erscheinungsjahr angegeben, z. B. (Müller, 2020).
Vancouver-Stil (numerisches System): Die Quellen werden im Text mit fortlaufenden Zahlen gekennzeichnet, z. B. [1], und im Literaturverzeichnis nummeriert gelistet.
Chicago-Stil (Fußnoten-System / deutsche Zitierweise): Die Quelle wird über eine Fußnote am Seitenende angegeben, meist mit vollständiger Literaturangabe.
Welchen Zitierstil du verwendest, hängt von deiner Fachrichtung, den Vorgaben deiner Universität und den Präferenzen deiner Betreuungsperson ab. Allerdings ist es entscheidend, dass du nur einen Zitierstil konsequent in der gesamten Arbeit anwendest.
Direktes und indirektes Zitieren
Beim wissenschaftlichen Arbeiten unterscheidest du zwischen direkten und indirekten Zitaten:
Direkte Zitate übernehmen den exakten Wortlaut einer Quelle und werden in Anführungszeichen gesetzt. Diese solltest du sparsam verwenden und nur dann einsetzen, wenn der genaue Wortlaut oder ein bestimmter Begriff besonders wichtig ist.
Indirekte Zitate geben den Inhalt einer Quelle in eigenen Worten wieder. Sie werden nicht in Anführungszeichen gesetzt, benötigen jedoch ebenfalls eine Quellenangabe. Bei der Harvard-Zitierweise und der deutschen Zitierweise werden indirekte Zitate mit „vgl.“ (vergleiche) eingeleitet. Durch eigene Formulierungen zeigst du, dass du den Originaltext verstanden hast und ihn in deine Argumentation einbinden kannst.
Literaturverzeichnis erstellen
Das Literaturverzeichnis steht am Ende deiner Diplomarbeit nach dem Fazit und vor dem Anhang. Hier listest du alle verwendeten Quellen vollständig auf, damit deine Leserschaft zitierte oder paraphrasierte Stellen selbst nachschlagen kann.
Grundsätzlich wird das Literaturverzeichnis alphabetisch nach den Nachnamen der Autorenschaft geordnet. Bei mehreren Quellen von einem Autor werden diese nach Erscheinungsjahren sortiert. Mehrere Autoren werden durch Schrägstrich oder Semikolon getrennt.
Eine vollständige Quellenangabe enthält je nach Quellenart verschiedene Informationen, darunter:
- Name und Vorname der Autorenschaft
- Erscheinungsjahr
- Titel und ggf. Untertitel
- Erscheinungsort und Verlag
Beachte außerdem: Im Literaturverzeichnis führst du ausschließlich jene Quellen auf, die du auch tatsächlich in deiner Arbeit zitiert oder paraphrasiert hast.
Korrekturphase: Deine Diplomarbeit perfektionieren
Nach monatelanger Arbeit an deinem wissenschaftlichen Werk ist die Korrekturphase entscheidend für den Erfolg deiner Diplomarbeit. Diese Phase wird oft unterschätzt, obwohl wissenschaftliche Texte in einem mühsamen Prozess des ständigen Neuschreibens und Feilens entstehen. Der letzte Schliff kann den Unterschied zwischen einer guten und einer hervorragenden Abschlussarbeit ausmachen.
Selbstkorrektur durchführen
Die wirkungsvolle Selbstkorrektur erfordert zunächst Abstand zu deinem Text. Lasse deine Diplomarbeit mindestens einen Tag ruhen, um Betriebsblindheit zu vermeiden. Beim erneuten Lesen solltest du verschiedene Perspektiven einnehmen:
- Überprüfe die Gliederung und innere Logik deiner Arbeit
- Kontrolliere Inhalt, Form und Stil deines Textes
- Überprüfe die Rechtschreibung (auch mit elektronischen Hilfsmitteln)
- Achte auf einheitliche Zitierweise
Besonders wirksam ist das laute Vorlesen einzelner Sätze oder des gesamten Textes. Außerdem empfiehlt es sich, nicht immer von Anfang bis Ende zu überarbeiten, sondern auch vom Ende zum Anfang – ähnlich wie beim Erlernen eines Musikstücks.
Feedback einholen
Textfeedback von Kommilitonen oder Freunden ist äußerst wertvoll, da sie deine subjektiven Leseeindrücke spiegeln können. Dabei sollte dein Gegenüber den Text nicht bewerten, sondern möglichst wertfrei formulieren, wie es ihm beim Lesen ergangen ist.
Das beste Feedback erhältst du, wenn dein Text bereits ausformuliert ist, aber noch überarbeitet werden kann. Mündliches Feedback ist dabei effektiver als schriftliches, da durch die persönliche Interaktion besser eingeschätzt werden kann, wie das Feedback ankommt.
Plagiatsprüfung durchführen
Vor der Abgabe ist eine Plagiatsprüfung unerlässlich. An vielen Hochschulen gibt es ein klar geregeltes Verfahren: Nach dem Hochladen deiner Arbeit auf den Hochschulschriftenserver wird sie automatisch mittels spezieller Software auf Textgleichheiten überprüft.
Allerdings solltest du selbst eine Überprüfung vornehmen, bevor du deine Arbeit abgibst. Verschiedene Online-Tools wie Scribbr oder andere Anbieter ermöglichen eine detaillierte Prüfung auf mögliche Plagiate. Beachte: Selbst versehentliche Plagiate können zu akademischen Konsequenzen wie Exmatrikulation oder der Aberkennung des Titels führen – und Plagiate verjähren nicht!
Angst vor Plagiaten?
Hätten wir auch. Nur ein Plagiatsvorwurf kann deine ganze Zukunft zerstören..
..deshalb kommt StudyTexter mit unabhängigen Plagiate Prüfbericht von PlagiarismSearch.com
Jede Arbeit zu 100% nur für dich geschrieben!

Unterstützung durch KI beim Schreiben der Diplomarbeit
Wie wir gesehen haben, kann das Schreiben einer Diplomarbeit eine anspruchsvolle Aufgabe sein, die viel Zeit und Sorgfalt erfordert. Dabei kann Studytexter als KI-Tool eine erhebliche Erleichterung verschaffen, indem es verschiedene wichtige Aspekte des Prozesses effizienter gestaltet. Es hilft nicht nur bei der Literaturrecherche, sondern auch beim Exzerpieren von Quellen, der korrekten Anwendung von Zitierstandards und der Plagiatsprüfung. All diese Funktionen tragen dazu bei, dass du deine Diplomarbeit nicht nur schneller, sondern auch fehlerfreier und wissenschaftlich korrekt erstellen kannst.
Du bekommst:
Einen Entwurf für deine gesamte Arbeit mit bis zu 120 Seiten Fließtext
Eine umfassende Literaturrecherche, inklusive Zusammenfassung zu jeder Quelle
Einen unabhängigen Prüfbericht zur Plagiatsprüfung
Einen unabhängigen Prüfbericht zur KI-Erkennung im Text
Eine logisch aufgebaute Arbeit mit rotem Faden von Anfang bis Ende
Echte Fakten aus über 224.000.000+ wissenschaftlichen Quellen
Verfügbar in 147+ Sprachen
Lieferung bequem per E-Mail in weniger als 4 Stunden
Einfache Bearbeitung als fertiges Word-Dokument
Studytexter bietet eine wertvolle Unterstützung für Studierende, die ihre Diplomarbeit effizient und korrekt schreiben möchten. Durch die Nutzung dieses KI-Tools kannst du sicherstellen, dass du nicht nur Zeit sparst, sondern auch den wissenschaftlichen Anforderungen gerecht wirst.
Fazit
Die Diplomarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zum akademischen Abschluss dar und erfordert nicht nur fundierte Fachkenntnisse, sondern auch eine präzise Planung und methodische Herangehensweise. Vom Finden eines geeigneten Themas und der Formulierung einer klaren Forschungsfrage über die Literaturrecherche und die Wahl der richtigen Methodik bis hin zum strukturierten Schreiben und der sorgfältigen Korrekturphase – jeder Schritt ist entscheidend für den Erfolg deiner Arbeit.
Ein klarer Fokus auf wissenschaftliche Ansprüche wie Nachvollziehbarkeit, Validität und Objektivität ist ebenso wichtig wie die Einhaltung formaler Anforderungen. Eine gut strukturierte Diplomarbeit bietet nicht nur eine fundierte Antwort auf die Forschungsfrage, sondern leistet einen Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs.
Denke daran, dass die Diplomarbeit nicht nur eine Herausforderung darstellt, sondern auch eine wertvolle Gelegenheit, dein Wissen und deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Mit einer systematischen Herangehensweise, der richtigen Methodik und einer sorgfältigen Korrektur kannst du deine Diplomarbeit erfolgreich abschließen und eine solide Grundlage für deinen akademischen Abschluss schaffen.
Wie beginne ich am besten mit meiner Diplomarbeit?
Starte mit einer gründlichen Recherche und finde ein Thema, das Dich interessiert. Formuliere dann eine präzise Forschungsfrage, erstelle einen realistischen Zeitplan und stimme Dein Thema frühzeitig mit Deiner Betreuungsperson ab. Die Einleitung solltest Du erst schreiben, wenn der Hauptteil weitgehend steht – so wirkt sie runder und zielgerichteter.
Wie lange dauert es üblicherweise, eine Diplomarbeit zu verfassen?
In der Regel hast Du etwa sechs Monate Zeit für Deine Diplomarbeit. In diesem Zeitraum solltest Du einen Umfang von ca. 60–100 Seiten erreichen und wissenschaftlich fundierte Ergebnisse zu Deiner Forschungsfrage liefern.
Welche Elemente sind für eine erfolgreiche Diplomarbeit besonders wichtig?
Wichtig sind eine klar formulierte Forschungsfrage, eine systematische Literaturrecherche, der gezielte Einsatz wissenschaftlicher Methoden sowie eine logische, gut strukturierte Gliederung mit rotem Faden. Achte außerdem auf korrektes Zitieren und nimm Dir genügend Zeit für die Korrekturphase.
Wie gehe ich bei der Literaturrecherche für meine Diplomarbeit vor?
Nutze wissenschaftliche Datenbanken, Fachportale und Bibliotheken. Beurteile jede Quelle kritisch: Ist sie aktuell, relevant und seriös? Halte wichtige Inhalte in Exzerpten fest und verwalte Deine Literatur übersichtlich – z. B. mit Tools wie Citavi, Zotero oder Mendeley.
Wie kann ich sicherstellen, dass meine Diplomarbeit frei von Plagiaten ist?
Mach vor der Abgabe unbedingt eine Plagiatsprüfung – viele Online-Tools und Programme helfen Dir dabei. Achte beim Schreiben darauf, Zitate korrekt zu kennzeichnen und fremde Inhalte richtig zu paraphrasieren. Schon kleine Fehler können als Plagiat gewertet werden und ernsthafte Folgen haben.