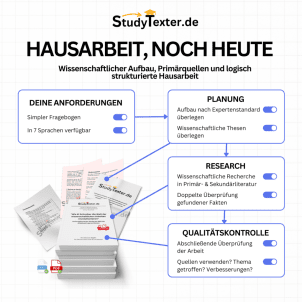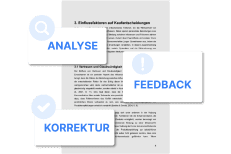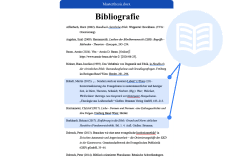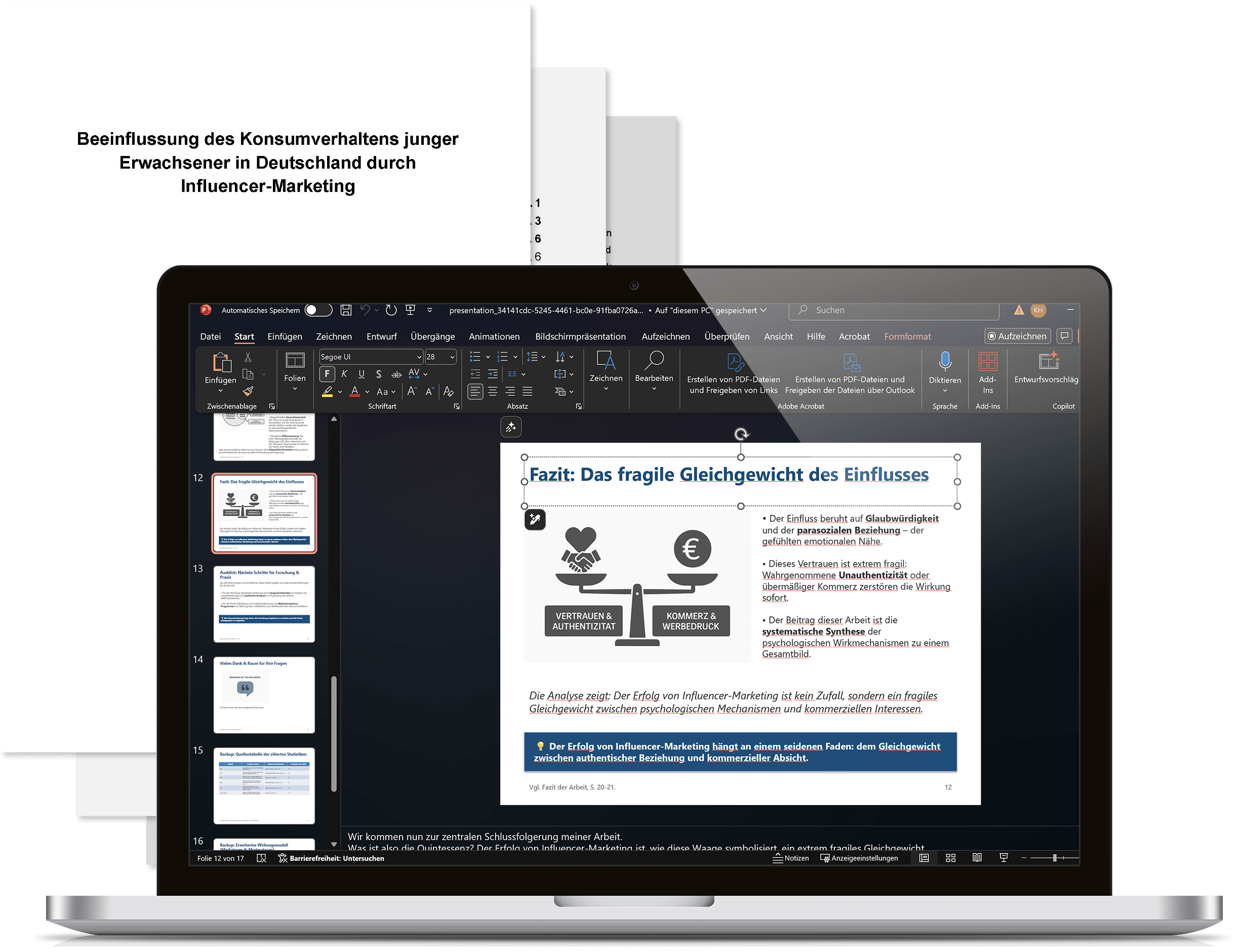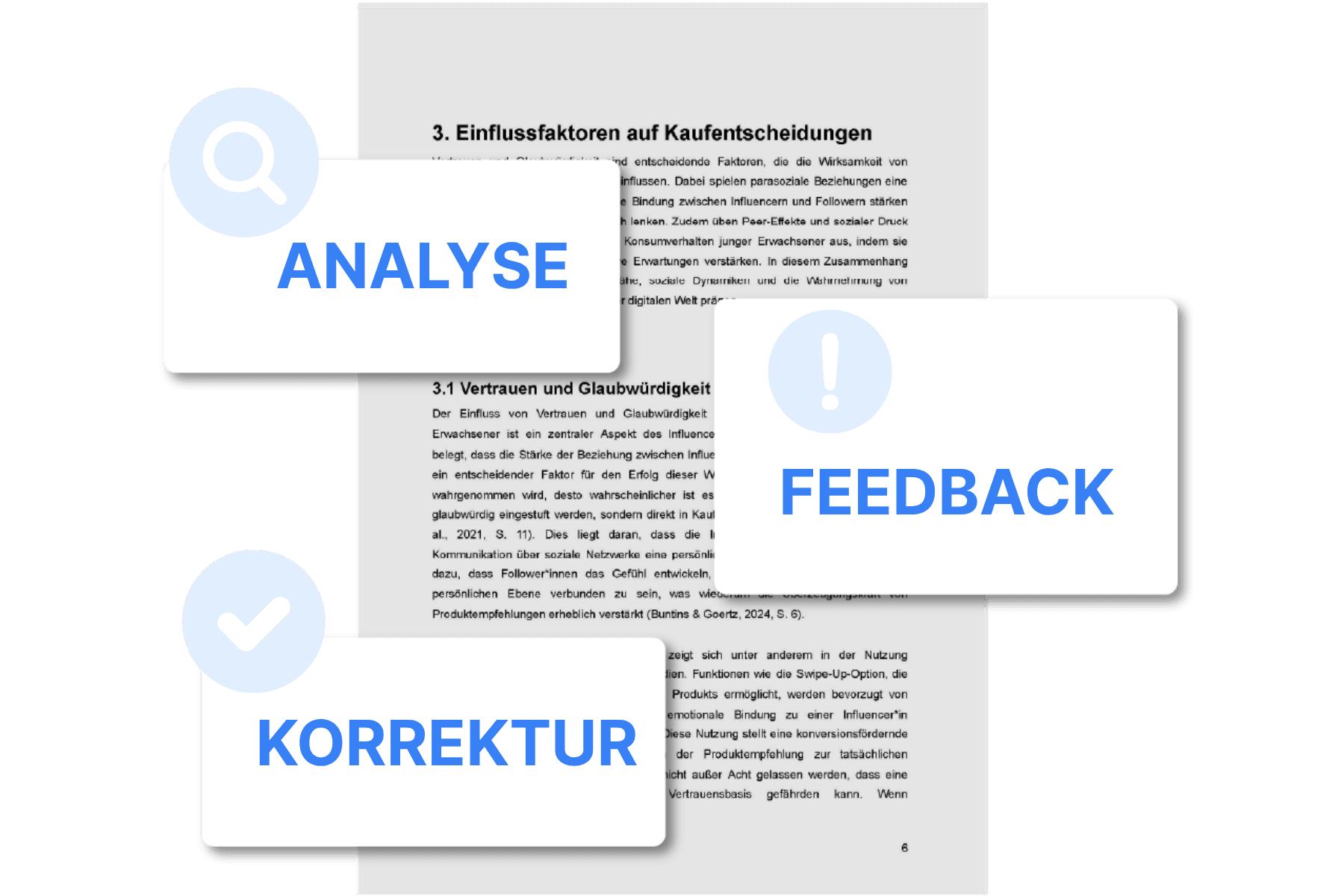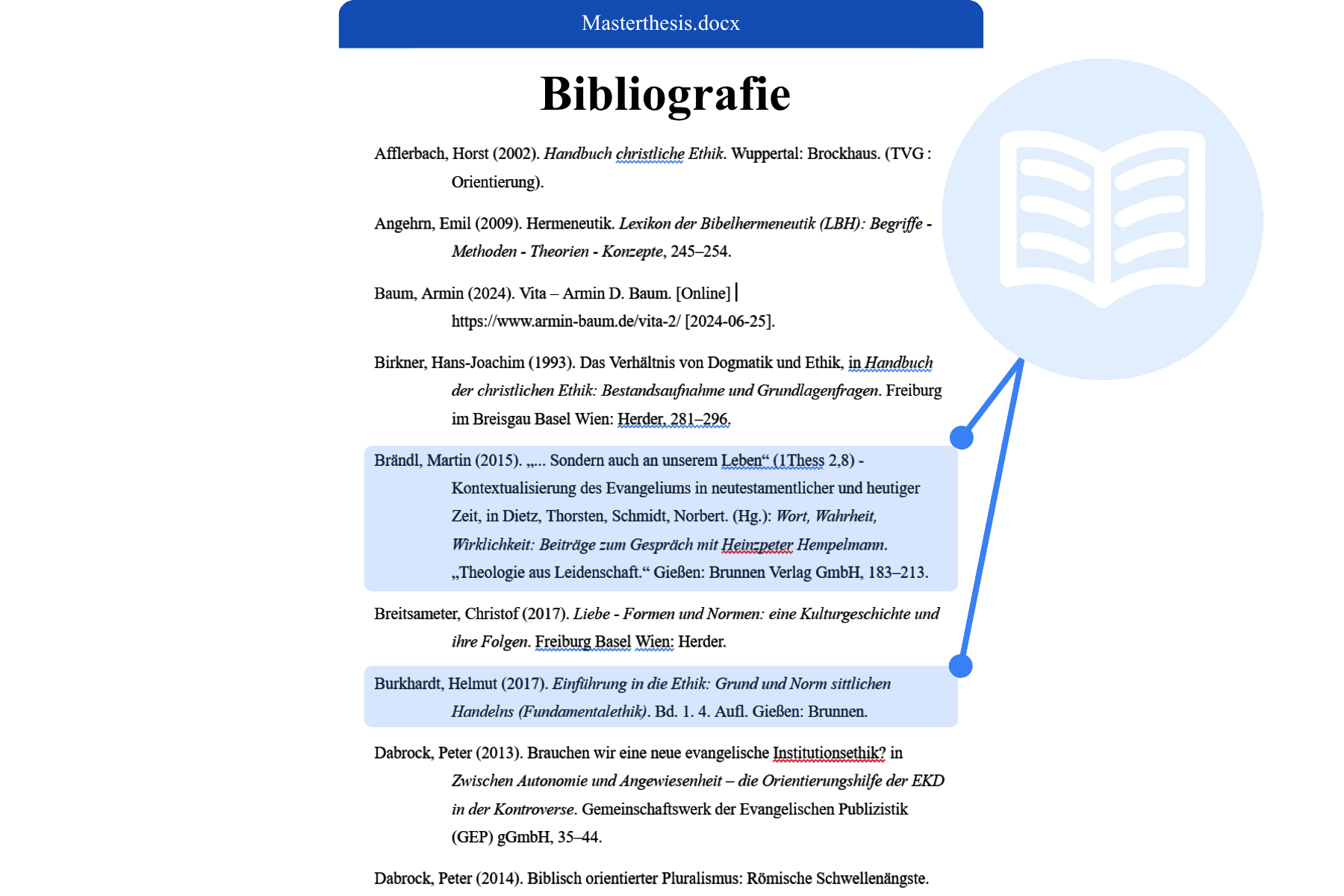Einleitung
Wenn du gerade an deiner Hausarbeit, Bachelor- oder Masterarbeit sitzt, kennst du das Problem vielleicht: Du hast ein spannendes Thema und erste Ideen – aber wie baust du den Methodenteil deiner empirischen Arbeit richtig auf? Welche Infos müssen rein? Und wie formulierst du das Ganze wissenschaftlich korrekt, aber verständlich?
In diesem Artikel zeige ich dir, wie du deinen Methodenteil sicher aufbaust, welche Fragen du beantworten solltest und gebe dir ein konkretes Beispiel für mehr Orientierung. Zusätzlich bekommst du Hinweise, wie du typische Fehler vermeidest – und wie dir smarte Tools und Vorlagen dabei helfen können, Zeit zu sparen.
1. Wozu dient der Methodenteil – und was muss rein?
Der Methodenteil beschreibt genau, wie du bei deiner Forschung vorgegangen bist. Das Ziel: Dein Vorgehen soll für andere nachvollziehbar und wiederholbar sein. Das ist wichtig, damit deine Ergebnisse glaubwürdig und wissenschaftlich sauber wirken.
👉 In deinen Methodenteil gehören in der Regel folgende Infos:
- Art der Forschung: qualitativ, quantitativ oder gemischt?
- Studiendesign: Wie war dein Aufbau? (z. B. Umfrage, Interviews, Experiment)
- Stichprobe: Wen hast du untersucht? Wie viele Personen? Wie ausgewählt?
- Instrumente: Welche Fragebögen, Interviewleitfäden oder Software hast du genutzt?
- Ablauf der Erhebung: Wo, wann und wie wurden Daten gesammelt?
- Datenanalyse: Welche Methoden der Auswertung hast du angewendet?
🎯 Tipp: Halte dich an die Regel: „So beschreiben, dass jemand anderes deine Studie genauso durchführen könnte.“ Einige Unis (z. B. Uni Kassel) geben sogar konkrete Hinweise zur Länge und Sprache des Methodenteils.
2. Beispiel für einen gelungenen Methodenteil
Ein konkretes Beispiel macht vieles klarer. So könnte ein Methodenteil aussehen:
„Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine quantitative Online-Umfrage mit 210 Studierenden der Universität Köln durchgeführt. Die Stichprobe bestand aus Bachelor-Studierenden im Alter von 19–28 Jahren. Als Erhebungsinstrument wurde ein standardisierter Fragebogen zur Studienzufriedenheit verwendet, der auf dem SFQ-Standard basiert. Die Umfrage lief zwei Wochen im Mai 2025. Im Anschluss wurden die Daten mit SPSS deskriptiv und inferenzstatistisch ausgewertet.“
Dieses Beispiel zeigt, wie du mit l erklärst, was du gemacht hast – ohne unnötige Details, aber mit allen wichtigen Infos.
3. Typische Fehler im Methodenteil – und wie du sie vermeidest
Gerade beim ersten Methodenteil passieren schnell typische Fehler. Hier einige No-Gos – und wie du sie umgehst:
❌ Fehler | ✅ Besser so | 💡 Warum das wichtig ist |
Vage oder unkonkrete Angaben: „Ich habe Leute befragt.“ | „Es wurden 30 Interviews mit Lehrkräften an Gymnasien in NRW geführt.“ | Je genauer du bist, desto glaubwürdiger und nachvollziehbarer ist deine Forschung. |
Fehlende Begründung: „Ich habe qualitative Interviews gemacht.“ | „Qualitative Interviews eignen sich, um individuelle Perspektiven zu erfassen.“ | Deine Methodenwahl muss begründet sein – sonst wirkt dein Vorgehen beliebig. |
Vermischung von Ergebnissen und Methodik: „Die Befragten waren sehr zufrieden.“ | Ergebnisse gehören in ein eigenes Kapitel – im Methodenteil beschreibst du nur das Vorgehen. | Trenne strikt zwischen „Was hast du gemacht?“ und „Was kam dabei heraus?“ |
| Zu viel Fachsprache / unverständliche Formulierungen | Klare, einfache Sprache nutzen: „Die Interviews dauerten je ca. 30 Minuten und wurden aufgezeichnet.“ | Verständlichkeit geht vor – auch Prüfer freuen sich über klaren Stil. |
| Unstrukturierte Darstellung | Unterkapitel und ggf. Tabellen verwenden: z. B. Stichprobe, Ablauf, Instrumente | Eine saubere Gliederung zeigt, dass du planvoll vorgegangen bist. |
4. Weiteres Beispiel: Methodenteil einer qualitativen Bachelorarbeit
Wenn du eine rein qualitative empirische Arbeit schreibst – zum Beispiel in Pädagogik, Soziologie oder Kulturwissenschaft – sieht dein Methodenteil natürlich etwas anders aus. Hier geht es meist nicht um große Stichproben und Statistik, sondern um tiefergehende Einzelfallanalysen, z. B. durch Interviews oder Gruppendiskussionen.
So könnte ein Methodenteil in einer qualitativen Arbeit aussehen:
„Für die vorliegende Untersuchung wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt, um die subjektiven Perspektiven von Grundschullehrkräften auf digitale Unterrichtsmethoden zu erfassen. Als Methode kamen halbstrukturierte Interviews mit sechs Grundschullehrkräften aus Nordrhein-Westfalen zum Einsatz. Die Auswahl erfolgte gezielt nach Schulform und Berufserfahrung, um eine möglichst heterogene Stichprobe zu erreichen. Die Interviews fanden im Zeitraum März bis April 2025 per Videokonferenz statt und dauerten jeweils etwa 45 Minuten. Alle Gespräche wurden aufgezeichnet, wörtlich transkribiert und im Anschluss mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Die Analyse erfolgte in mehreren Schritten: Zunächst wurden deduktive Kategorien aus der Literatur entwickelt, anschließend wurden induktiv neue Kategorien ergänzt, die sich aus dem Material ergaben.“
🔎 Was du an diesem Beispiel erkennst:
- Es wird klar benannt, was untersucht wurde (Lehrkräfte, digitales Unterrichten).
- Die Methodenwahl wird begründet (qualitative Interviews für subjektive Sichtweisen).
- Die Stichprobenstrategie ist beschrieben (gezielte Auswahl).
- Der Ablauf der Erhebung ist transparent.
- Die Auswertungsmethode wird nicht nur genannt, sondern auch erklärt.
🎯 Extra-Tipp: Wenn du mit qualitativen Daten arbeitest, achte darauf, wie du transkribierst und wie du deine Auswertung systematisierst – das sollte im Methodenteil immer kurz erklärt werden.
Fazit: So gelingt dein Methodenteil
Der Methodenteil ist das Herzstück deiner empirischen Arbeit. Wenn du dein Vorgehen klar, nachvollziehbar und gut begründet darstellst, legst du die Basis für glaubwürdige Ergebnisse. Ob du Interviews führst oder eine Umfrage auswertest – mit einem strukturierten Aufbau und konkreten Beispielen behältst du den Überblick.
StudyTexter kann dich dabei unterstützen – insbesondere beim Theorieteil deiner Arbeit. Zwar übernehmen wir keine Datenerhebung, aber wir helfen dir, deine Forschungsfrage sauber einzuordnen, passende Literatur zu finden und deine Argumentation wissenschaftlich aufzubauen. So sparst du Zeit – und gewinnst an Qualität
Häufig gestellte Fragen
1. Wie lang sollte der Methodenteil sein?
Das hängt vom Umfang deiner Arbeit ab. In einer Bachelorarbeit macht der Methodenteil meist etwa 10–15 % des Gesamtumfangs aus – also z. B. 4–6 Seiten bei 40 Seiten Gesamttext. Wichtig ist: Schreib so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich.
2. Muss ich meine Methoden begründen?
Ja! Du solltest immer kurz erklären, warum du dich für eine bestimmte Methode entschieden hast – z. B. warum du qualitative Interviews statt einer Umfrage gewählt hast. Das zeigt, dass dein Vorgehen durchdacht ist.
3. Was gehört nicht in den Methodenteil?
Ergebnisse oder Interpretationen haben im Methodenteil nichts zu suchen. Auch lange Theorieteile oder Definitionen solltest du vermeiden – die gehören in den theoretischen Rahmen.
4. Wie formuliere ich den Methodenteil am besten?
Schreibe sachlich, klar und im Präteritum (Vergangenheit), da du abgeschlossene Vorgänge beschreibst. Fachlich korrekt, aber verständlich – so sollte der Ton sein.
5. Kann mir StudyTexter beim Methodenteil helfen?
Wenn du literaturbasiert arbeitest, ja! StudyTexter unterstützt dich beim Aufbau, der Struktur und Ausformulierung deines Theorieteils. Für empirische Datenerhebungen selbst können wir dir aktuell keine direkte Hilfe bieten – aber beim wissenschaftlichen Rahmen deiner Forschung schon.