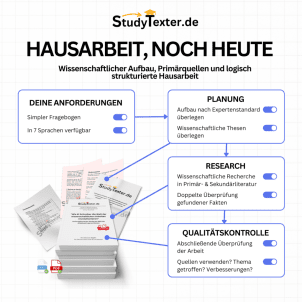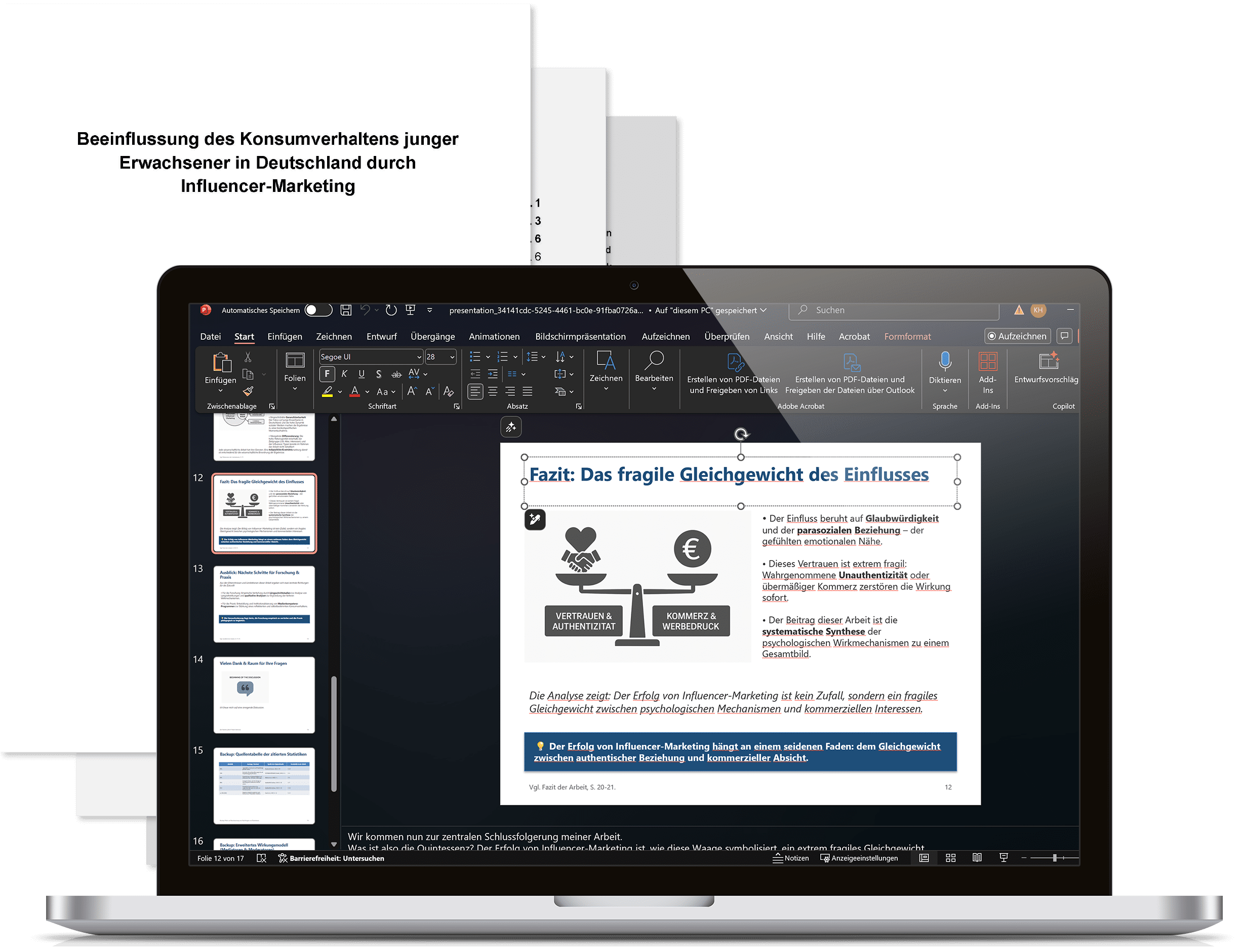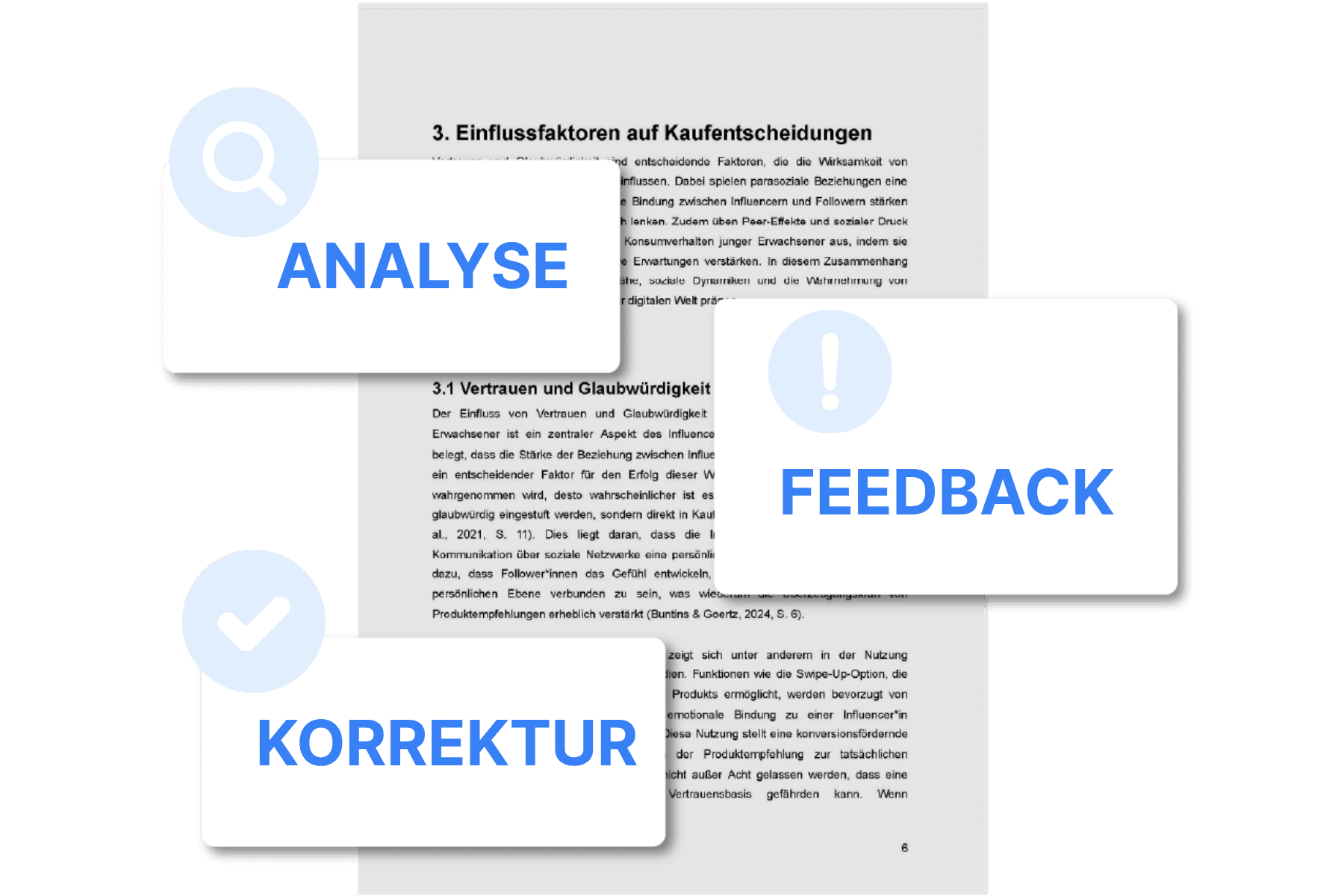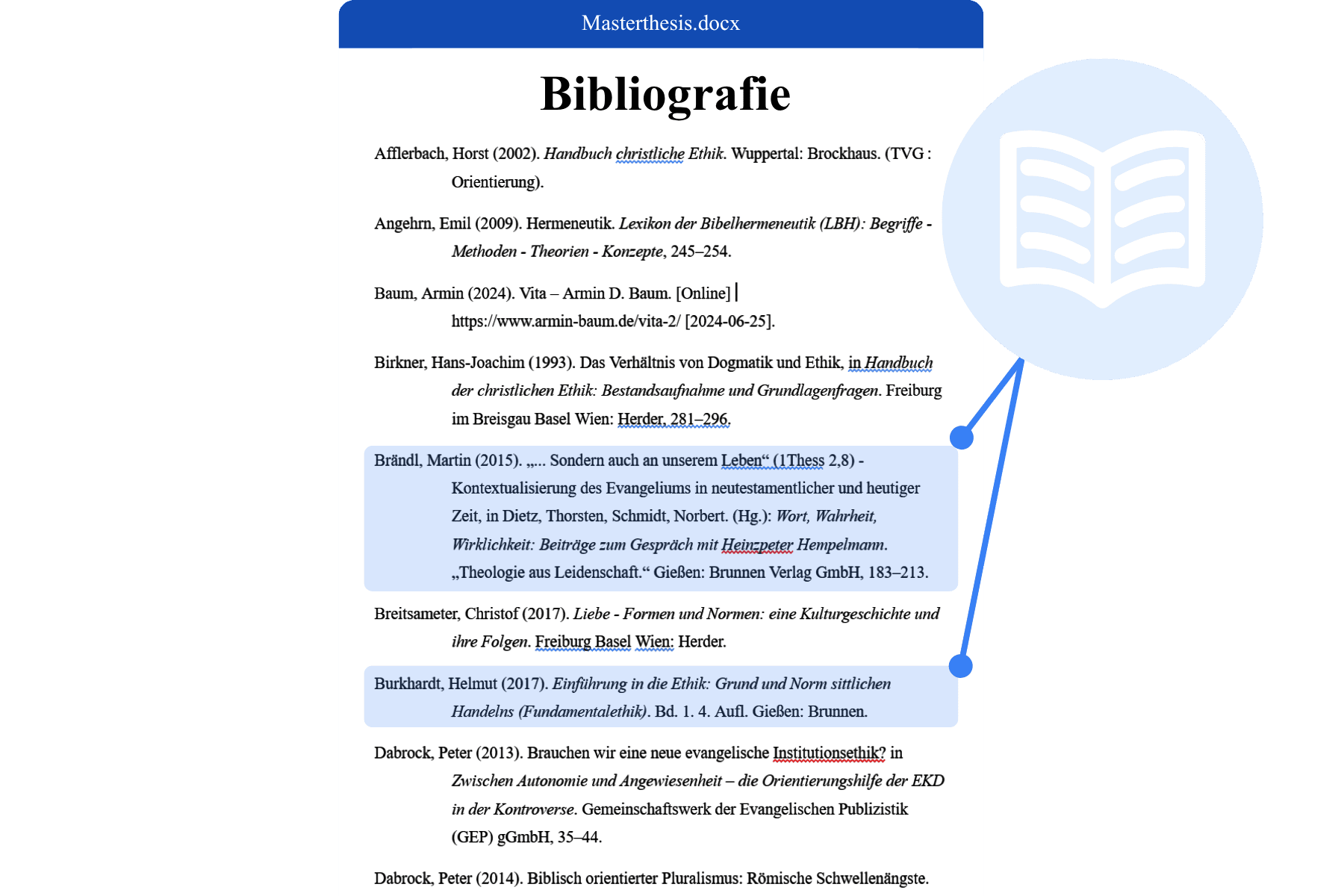Einleitung
Die Einleitung deiner Bachelorarbeit ist kein lästiger Pflichtteil – sie ist der erste Eindruck, den du bei deinem Prüfer hinterlässt. In wenigen Absätzen musst du zeigen: Ich habe ein relevantes Thema, ein klares Ziel und weiß genau, worauf ich hinaus will. Wer hier überzeugt, hat das Interesse des Lesers auf seiner Seite.
Und keine Sorge: Die Einleitung schreibt man nicht zuerst – sondern am besten zum Schluss, wenn alles andere steht. Erst dann kannst du den roten Faden sauber spannen.
1. Das gehört in eine gelungene Einleitung
Damit deine Einleitung alle Anforderungen erfüllt, orientiere dich an diesen sechs zentralen Punkten:
- Thema & Kontext: Worum geht es in deiner Arbeit – und in welchem wissenschaftlichen Zusammenhang steht das Thema?
- Relevanz: Warum ist das Thema aktuell oder fachlich bedeutsam? Gibt es gesellschaftliche, wirtschaftliche oder wissenschaftliche Bezüge?
- Forschungsfrage: Was genau willst du herausfinden? Diese Frage ist das Herzstück deiner Arbeit.
- Zielsetzung: Welche Absicht verfolgst du mit deiner Untersuchung – und worauf arbeitest du hin?
- Methodik: Mit welchen Methoden beantwortest du deine Frage? Theoretisch, empirisch, experimentell?
- Aufbau der Arbeit: Gib einen knappen Überblick über die folgenden Kapitel – so bereitest du den Leser auf den weiteren Verlauf vor.
Tipp: Schreib deine Einleitung so, dass auch jemand ohne tiefes Vorwissen versteht, worum es geht. Ziel ist Klarheit – nicht Fachchinesisch.
2. Wie du deinen Leser direkt abholst
Viele Einleitungen beginnen mit Sätzen wie: „In dieser Arbeit soll…“ oder „Die folgende Untersuchung beschäftigt sich mit…“ – und genau da schlägt die Gähn-Attacke zu. Du willst Interesse wecken, keine Floskeln abspulen.
Stattdessen:
- Starte mit einer Frage oder einem spannenden Fakt: Etwa: „Warum werden in Großraumbüros mehr Krankentage gezählt als im Homeoffice?“
- Zeige einen persönlichen Bezug: „Während meines Praktikums fiel mir auf, dass…“
- Nutze ein prägnantes Zitat aus der Forschung: Das zeigt, dass du dich auskennst.
Ein kurzer, prägnanter Einstieg mit echtem Bezug zum Thema bleibt im Kopf. Und sorgt dafür, dass dein Prüfer weiterlesen will – nicht weiterblättert.
Hier sind drei Beispiel-Einstiege für Einleitungen der Bachelorarbeit, jeweils passend zu einem Fachbereich.
Beispiel 1 – Betriebswirtschaftslehre (BWL)
„Warum wechseln 47 % aller Kunden nach nur einem negativen Service-Erlebnis den Anbieter? Diese Zahl aus einer aktuellen Studie des IFH Köln wirft ein Schlaglicht auf die Bedeutung von Kundenbindung im digitalen Zeitalter. Im Zentrum dieser Arbeit steht die Frage, wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) durch automatisiertes Kundenfeedback die Servicequalität systematisch verbessern können.“
Was hier gut funktioniert:
- Provokanter Fakt zu Beginn (Interesse!)
- Relevanz durch aktuellen Kontext
- Klare Überleitung zur eigenen Forschungsfrage
- Wissenschaftlich, aber verständlich
Beispiel 2 – Psychologie / Sozialwissenschaften
„Während der Corona-Pandemie berichteten viele Menschen über eine erhöhte Nutzung sozialer Netzwerke – nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch zur emotionalen Entlastung. Doch welche Auswirkungen hat diese digitale Selbstoffenbarung auf das subjektive Wohlbefinden junger Erwachsener? Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Selbstoffenbarung auf Instagram und dem erlebten Stressniveau bei Studierenden im Alter von 20 bis 30 Jahren.“
Was hier gut funktioniert:
- Aktueller, gesellschaftlich relevanter Kontext
- Fokus auf eine konkrete Zielgruppe
- Forschungsfrage direkt im Anschluss
- Emotionaler und wissenschaftlicher Einstieg in Balance
Beispiel 3 – Maschinenbau / Ingenieurwissenschaften
„Die additive Fertigung hat das Potenzial, Lieferketten grundlegend zu verändern – doch wie zuverlässig sind 3D-gedruckte Bauteile unter thermischer Belastung? Am Beispiel einer neu entwickelten Aluminiumlegierung wird in dieser Arbeit untersucht, wie sich Mikrostruktur und Festigkeit nach wiederholtem Wärmeeinfluss verändern. Ziel ist es, Einsatzgrenzen im industriellen Dauerbetrieb besser bewerten zu können.“
Was hier gut funktioniert:
- Einstieg über technische Relevanz / Problemstellung
- Konkretes Untersuchungsobjekt
- Deutliche Zielsetzung und Nutzen für Praxis
- Präzise Sprache, wie in MINT-Fächern üblich
3. Häufige Fehler – und wie du sie vermeidest
Hier ein paar Klassiker, die du leicht umgehen kannst:
❌ Die Einleitung zu früh schreiben: Erst wenn du weißt, was du im Hauptteil gesagt hast, kannst du eine sinnvolle Einleitung formulieren.
✅ Besser: Mach dir zuerst Notizen, aber schreibe die finale Einleitung am Schluss.
❌ Ergebnisse vorwegnehmen: Nimm dem Leser nicht die Spannung – die Antwort gehört ins Fazit.
✅ Besser: Stelle kluge Fragen, keine fertigen Antworten.
❌ Allgemeinplätze statt Relevanz: „Die Digitalisierung ist wichtig…“ – ja, aber warum genau für dein Thema?
✅ Besser: Zeig, was das Thema konkret in deinem Fachkontext bedeutet.
👉 Extra-Tipp: Lies deine Einleitung laut. Klingt sie flüssig und klar? Oder wie ein Paragraph aus dem Amtsblatt?
4. Mit Struktur und Stil punkten
Die Einleitung ist keine Wissenschaft für sich – aber sie folgt klaren Regeln. Und mit etwas Feinschliff wird sie zum Aushängeschild deiner Arbeit:
- Schreibe aktiv statt passiv: „Diese Arbeit untersucht…“ statt „In dieser Arbeit wird untersucht…“
- Verwende kurze Sätze: Maximal zwei Gedanken pro Satz – sonst wird’s sperrig.
- Vermeide Füllwörter und „Wort-Monster“: Lieber klar und einfach als geschwollen und unverständlich.
- Halte dich an den roten Faden: Alles, was du in der Einleitung erwähnst, sollte später auch behandelt werden.
Nutze gern die Leitfäden von Hochschulen wie der Uni Leipzig oder der Uni Duisburg-Essen für zusätzliche Hilfestellungen zur Struktur.
5. Wenn du nicht weiterkommst: Hier hilft dir StudyTexter
Du weißt, was in die Einleitung gehört, aber der erste Satz will einfach nicht fließen? Du bist unsicher, ob deine Formulierungen den wissenschaftlichen Ton treffen?
Bei StudyTexter bekommst du konkrete Hilfe – von der ersten Idee bis zum fertig formulierten Entwurf. Unsere KI analysiert deine Inhalte, recherchiert passende Quellen und erstellt auf Wunsch auch einen vollständigen Einleitungstext – inklusive Zielsetzung, Kontext und Methodik.
Besonders praktisch: Du kannst deine eigene Forschungsfrage hochladen und bekommst exakt darauf zugeschnittene Formulierungen. So sparst du Zeit – und gewinnst Sicherheit.
Fazit: Die Einleitung ist deine Visitenkarte
Eine gute Einleitung zeigt: Du weißt, worum es geht – und du hast etwas zu sagen. Sie ist kurz, klar und spannend. Kein Ort für Standardphrasen, sondern für echtes Interesse.
Mit den richtigen Fragen, einem sauberen Aufbau und etwas Sprachgefühl gelingt dir dieser Einstieg garantiert. Und wenn du doch mal feststeckst: Es gibt Tools, die dir helfen – ganz ohne Ghostwriting und mit wissenschaftlichem Anspruch. Probier’s aus – der erste Eindruck zählt!
Du willst mehr über die Einleitungen in Bachelorarbeiten erfahren, dann Klicke hier.
Häufig gestellte Fragen
1. Wann sollte ich die Einleitung meiner Bachelorarbeit schreiben?
Am besten ganz zum Schluss! Wenn du erst Hauptteil und Fazit fertig hast, weißt du genau, worauf du in der Einleitung hinführen musst. So sparst du dir lästiges Umschreiben und triffst den roten Faden viel präziser.
2. Wie lang darf die Einleitung sein?
Eine gute Faustregel: 5–10 % des Gesamtumfangs deiner Arbeit. Bei einer 30-seitigen Bachelorarbeit bedeutet das ca. 1,5 bis 3 Seiten. Kurz, aber gehaltvoll – vermeide unnötige Wiederholungen.
3. Muss ich in der Einleitung schon meine Ergebnisse nennen?
Nein. In der Einleitung formulierst du deine Forschungsfrage, nicht die Antwort darauf. Die Ergebnisse gehören ins Fazit. Die Einleitung soll neugierig machen – nicht spoilern.
4. Darf ich „Ich“ in der Einleitung verwenden?
In wissenschaftlichen Arbeiten wird meist auf die Ich-Form verzichtet. Statt „Ich untersuche…“ lieber „Diese Arbeit untersucht…“. Sachlich und objektiv ist hier die richtige Tonlage.
5. Was mache ich, wenn mir der Einstieg einfach nicht gelingt?
Starte mit einem spannenden Fakt, einer provokanten Frage oder einem Bezug zur Praxis. Und wenn du komplett feststeckst: Hol dir Hilfe – z. B. von StudyTexter. Die Plattform erstellt dir auf Wunsch einen passgenauen Einleitungstext, abgestimmt auf deine Fragestellung und dein Fachgebiet.